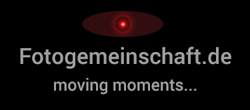Ein bisschen mehr Freude
Begegnungen in einem Pflegeheim
Ihr hohes Alter wunderte sie, ahnte Herta Schwant, als sie mir mit brüchiger, trockener Stimme ihr Leben erzählte, das nahe Ende? Ihre Brüder wären längst tot, und von den zehn Damen des Handarbeitskränzchens, alle etwa gleichen Jahrgangs, sei sie auch die Letzte. Wenige Tage nach unserem langen Gespräch schaute ich zu Herta herein, wollte ihr sagen, dass ich beim nächsten Besuch die Fotos mitbrächte. Die Tür stand offen. Sie lag da im engen Zimmer auf dem Bett, sehr müde, das eine, noch halbwegs gesunde Auge einen winzigen Spalt geöffnet. Es war ein „schönes“ Bild und ich drückte den Auslöser. Herta bemerkte mich, richtete sich mühsam auf. Es gehe ihr heute nicht gut, wir könnten uns aber trotzdem etwas unterhalten. „Machen wir morgen, Herta. Bis dahin gute Besserung!“ Wenige Stunden später war Herta Schwant tot.
„Sie wissen doch“, meinte die Schwester lakonisch am Telefon, „wer hier rauskommt, tut das mit den Füßen zuerst.“ Schlechtes Gewissen bleibt. Hätte ich an jenem Tag nicht doch ein bisschen schwätzen sollen mit Herta?
Die drückt mir auf die Seele
Die Frau, mit der sie sich das Zimmer teilen musste, drückte ihr auf die Seele. Kein Wort könne sie mit der sprechen, kein Guten Morgen, nichts. Immer nur schlafen wolle die. Und bitter fügt die 88jährige Herta Schwant hinzu, diese Frau habe noch nie einen Arzt gebraucht, schlucke nichtmal Tabletten.
Hertas ungeliebte Zimmergenossin sitzt mit den anderen, die immer hier sitzen, im Fernsehraum auf dem Sofa, schläft oder starrt wortlos ins Nichts. Manchmal weint sie, einfach so, scheinbar ohne Grund. Dann ist es wieder bedrückend still in diesem vor sich hin dämmernden Kreis. Keiner beachtet das bunte Fernsehbild. Was sollte auch noch zu sagen sein, wenn alle Lebensgeschichten erzählt sind? Warten auf die nächste Mahlzeit nebenan im großen Speiseraum. Oder auf den nächsten Ausbruch der Blonden rechts im Sessel. Von der kommt, wie aus dem Nichts, ein Angriff auf die gegenüber Sitzende. Sie solle von hier verschwinden, wo sie doch sowieso nur überall hinpisse- und scheiße. Unvermittelte Aggression wie ein verzweifeltes Aufbäumen gegen dieses Dahinleben in ungewünschter Gemeinschaft.
Herta Schwant war zwei Jahre vor ihrem Tod in dieses Haus gekommen, aus einem Diabetikerheim, das wegen maroder Heizung geschlossen wurde. Sie kam zusammen mit ihrer Zimmergefährtin, die nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen konnte, auf den Pfingstberg. Dass sie bald danach einschlief, hatte Herta sehr getroffen. Die nächste, mit der sie das Zimmer teilen musste, schaffte es ein dreiviertel Jahr. Dann kam eine, die am vierten Tag nachts auf einen Stuhl stieg und hinschlug.
Herta hatte sich aus eigener Kraft durchs Leben schlagen müssen. Ein Mann kommt in ihrem Bericht nicht vor. Mit 34 überstand sie drei schwere Operationen, als sie 79 war löschte ein Tumor ein Augenlicht, im gleichen Jahr traf sie eine Brustamputation.
Herta hat also ihr freudloses Leben hinter sich gebracht. Warum berührt mich ihr Tod so? Ist es die traurige Faszination des Unwiderbringlichen? Oder der makabre Reiz, letzter Gesprächspartner gewesen zu sein, das letzte Foto geschossen zu haben? Vor mir liegt die Bandabschrift ihres Lebensberichts. „Mit denen hier kann man sich ja nicht unterhalten. Ich bin froh, wenn ich gegessen habe, dann verziehe ich mich gleich. Gestern hatten wir Puffer mit Apfelmus, vorgestern Königsberger Klopse. Und jeden Tag gibt es Kompott, denken sie mal! So viele Südfrüchte wie hier hatte ich ja vorher meinen Lebtag nicht gegessen.“
+++
Ich darf gar nicht daran denken
Helene Zeiger, die zierliche 84jährige Frau mit den großen Pantoffeln, gibt sich verlegen, als ich sie fotografieren will. Ihre Haare sähen schlimm aus. Dabei ist sie akkurat frisiert. Helene , die seit vier Jahren in diesem Pflegeheim lebt, hat zuerst nicht verstanden, dass ihre Worte aufgezeichnet werden. Als sie es nach unserem Gespräch bemerkt, treibt ihr die Furcht vielleicht etwas Falsches gesagt zu haben, fast die Tränen in die Augen. Mit schüchternem Stolz erzählt Helene von ihrer Anstellung als Zofe beim Herrn Generaldirektor Dr. Zell und der berühmten Schauspielerin Erika von … ich konnte den Namen einfach nicht verstehen.
Gelernt hatte sie auf dem Rittergut Uetz, wenige Kilometer von Potsdam. Weißnähen, Perlen sticken, Glanzwäsche bügeln. Nach dem Tod des Vaters im Ersten Weltkrieg war sie von der Schwester ihrer Mutter aus der Provinz Posen dorthin geholt worden. „Uetz gehörte Prinz Heinrich, der mit der blauen Mütze. Er kam ein Mal im Jahr, das Gut zu besichtigen. Und als ich ihm einmal Guten Tag sagen konnte, fragte der Prinz mich, woher ich denn käme.“ An ein zweites großes Ereignis kann sich Helene auch noch erinnern. „Der Sohn des Prinzen war gekommen. Ich hatte den Tisch gedeckt und die Prinzessin sagte: ‚Gott, haben sie das aber schön gemacht. Das sind ja unsere Landesfarben!’ Ich wusste das aber gar nicht, es war wirklich reiner Zufall.“
Helenes Mutter lernte auf dem Rittergut ihren zweiten Mann kennen. Er war Kutscher bei Herrn Treveranos, dem Herrscher über Gut und Leute. Helene fand in einem 28jährigen Oberinspektor ihre Jugendliebe. Sie dauerte zwei Jahre. „Uns haben die Leute auseinander gebracht. Der Gutsherr hat meinen Verlobten entlassen, warum, weiß ich nicht. Ich ging dann als Zofe nach Potsdam. Ein Mal besuchte mich mein Verlobter noch. Er bat, ihn zum Abschied zum Bahnhof zu begleiten. Ich hatte keine Zeit. Wir sahen uns dann nie wieder. An einen zweiten Mann wollte ich mich nur schwer gewöhnen und blieb Jahre allein. Als ich meinen Karl heiratete, war ich schon 31. Ich kannte ihn erst ein Jahr. Doch als der Krieg kam, dachte ich, vielleicht werden die meisten Männer tot geschossen und ich kriege dann keinen mehr ab. Er war Stadtsekretär. 30 Jahre lebten wir gut zusammen. Und dann sagte er an einem Sonntagmorgen zu mir: ‚Kleine, ich bekomme so schwer Luft.’ Er hatte ja viel geraucht, eine Schachtel am Tag. Eine halbe Stunde später schon war mein Karl tot. Ich darf gar nicht daran denken.“
+++
Da hängt man nicht am Leben
Berta Jainz sitzt dort, wo ich sie schon oft habe sitzen sehen – gleich hinter der steilen Treppe zum ersten Stock, in der Ecke am Speiseaufzug. Sie sieht mitgenommen aus, blass, das Gesicht eingefallen. Eine Magen-Darm-Geschichte hatte ihr, wie vielen hier, in den vergangenen Tagen zu schaffen gemacht. So gibt es zum Mittag Milchreis mit Zucker und Zimt, Bertas Sache ist das nicht. Sie isst lieber, was den Frauen unten im Liegezimmer eingelöffelt wird, Rührei mit Kartoffelbrei. Bertas jüngere Freundin mit der heiseren Stimme und der unübersehbaren Zahnlücke sitzt neben ihr. Die beiden halten sich von den anderen Heimbewohnern fern. Berta sagt: „Die meisten hier haben ja einen kleinen Tick unterm Pony, da muss man sich einfach zurückziehen. Manche drehen einem das Wort im Mund herum. Es ist schon traurig, unter solchen Leuten leben zu müssen. Ich hab’ ja meinen Grips zum Glück noch einigermaßen beisammen.“
Berta Jainz, 1903 geboren in einem Oberlausitzer Dorf, wurde im Alter von 22 Jahren zum ersten Mal von einem epileptischen Anfall zu Boden geworfen. Das wiederholte sich, jedes Jahr, immer aus heiterem Himmel. Mit 26 heiratete Berta. „Das hielt nur ein Jahr, die Schwestern meines Mannes waren gegen mich. Ich brachte wohl nicht genug mit in die Ehe. Wir waren doch zehn Geschwister …“ Enttäuscht verließ Berta das Dorf und verdingte sich als Haushaltshilfe in Thüringen. Im November 1930, kurz vor ihrem 28. Geburtstag, wurde Berta Jainz wegen der epileptischen Anfälle in die Landesanstalt Potsdam eingewiesen. 24 Jahre verbrachte sie in Görden am Rande der Havelstadt Brandenburg, überstand dort den Krieg, von dem sie nur die Bombenflugzeuge wahrnahm. „Die dröhnten da über den Wald. Angst spürte ich nicht. In so einem Heim leben zu müssen, da hängt man nicht am Leben.“
Aus Heimen ist Berta Jainz seit 1930 nicht mehr heraus gekommen. 27 Jahre hat sie nun schon ihr Bett im Pflegeheim auf dem Pfingstberg. Löst Kreuzworträtsel, „damit der Kopf nicht ganz vertrocknet“, freut sich auf den Frühling. „Wenn’s schön ist, gehen wir raus, wir haben da im Garten unsere Ecke.“
Berta, die der Zeit im Pflegeheim nachtrauert, da ein Mal im Monat zum Tänzchen aufgespielt wurde, führt mich in ihr schmales Zimmer und zeigt stolz auf einen gerahmten Spruch an der Wand.
Ein bißchen mehr Frieden und weniger Streit
Ein bißchen mehr Freude und weniger Neid
Und viel mehr Blumen während des Lebens,
Denn auf den Gräbern sind sie vergebens.
Die vollständige Fotostrecke:
Weitere Foto-Serien von Ulrich Joho findet ihr hier: https://www.fotogemeinschaft.de/v/fotografen/Ulrich-Joho/